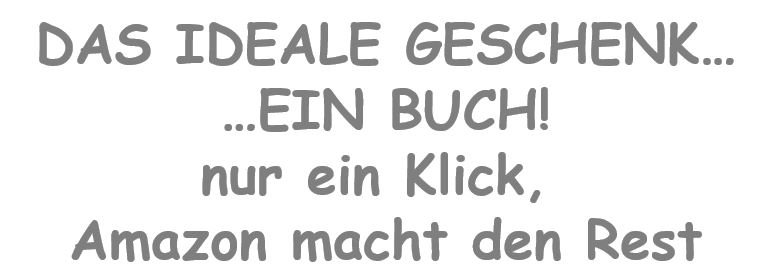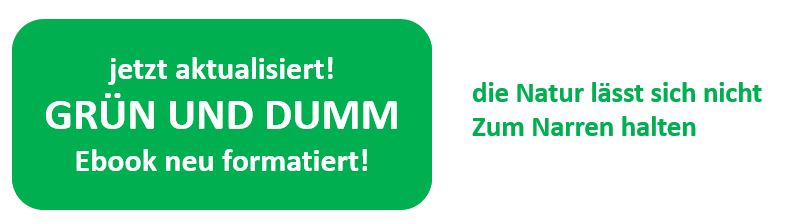Bild: Julius Drost / unsplash
From Rags to Riches
Der Karriere erster Teil
Mit dem frisch gedruckten Diplom in der Hand heuerte ich bei der Daimler-Benz AG als Versuchsingenieur an. Wir beschäftigten uns mit Fahrwerks- und Motorlagern, d. h. damit, wie man Unebenheiten der Straße und Vibrationen der Maschine am besten vom restlichen Auto abkoppelt, damit die Insassen es bequem haben. Es war offensichtlich ein technisch orientierter Job; ich machte das knapp fünf Jahre lang – gut, aber ohne Begeisterung.
Danach hatte ich eine Reihe von Anstellungen, allesamt bei Kfz-Zulieferern, allesamt als Manager. Meine Verantwortungen stiegen von einer Position zur nächsten und 2005, mit 42 Jahren, wurde ich Geschäftsführer der Paguag GmbH, einer 60-Millionen-Firma in Düsseldorf. Im Kapitel Piroska hatte ich ja darüber berichtet.
Auf dieser Karriereleiter verfolgte ich unerbittlich mein klares Ziel, das ich mir beim Empfang meines Facharbeiterbriefes 1983 gesetzt hatte: über DM 10.000 pro Monat und mit 55 genügend auf der hohen Kante, um nicht mehr arbeiten zu müssen. Mit jeder Sprosse nach oben fühlte ich, wie das Luftschloss immer greifbarer wurde. Dieses Gefühl ließ meine Anstrengungen nicht etwa abschlaffen, im Gegenteil, ich verlangte mir immer mehr ab.
Ebenso verlangte ich anderen viel ab. Ich war rücksichtslos auf mein Ziel orientiert, den Blick auf menschliche Seiten meines Jobs hielt ich durch Scheuklappen von mir fern. Mitarbeiter wurden unerbittlich angetrieben, bei Versagen gab’s keine Gnade, Gefangene wurden nicht gemacht. Kollegen wurden benutzt, wenn es zweckmäßig war, um dann bekämpft zu werden, wenn sie mir im Weg standen. Parallel dazu habe ich ständig, wie ein Falke, nach Chancen gespäht, um mein Gehalt aufzubessern, und ich habe sie alle genutzt.
Ich fraternisierte also nicht mit Kollegen, ich malochte in der Isolation. Das passte gut zu meiner Grundüberzeugung, dass mich eh niemand mochte. Solch ein Glauben hat die Tendenz, sich kontinuierlich selbst zu beweisen. Man geht nicht aufgeschlossen auf den Rest der Menschheit zu, wenn man sich nichts Gutes von ihr verspricht.
Dieser Teufelskreis wird in einer fernöstlichen Anekdote anschaulich geschildert: Ein junger Mönch kommt auf seiner Pilgerreise an einem weisen Mann vorbei und fragt ihn, ob die Menschen im nächsten Dorf wohl hilfsbereit und freundlich seien. „Wie waren sie denn im letzten Dorf?“, fragt der Weise zurück. „Sehr freundlich“, ist die Antwort. „Siehst du, mein junger Freund, so werden sie dann wohl auch im nächsten Dorf sein.“
In meiner Einsamkeit bekam ich nie ehrliches Feedback über die Qualität meiner Arbeit, ich konnte mich nicht mit anderen vergleichen. Also arbeitete ich so hart ich nur konnte und versuchte, keine Fehler zu machen. Denn Fehler machen tut weh – das hatte die Mutter mir beigebracht, als wir Diktate übten. Ohne es zu merken, war ich dabei in meinem Job verdammt gut geworden. Mir war es ähnlich ergangen wie dem Gefangenen aus Stefan Zweigs Schachnovelle, der in der Isolation seiner Einzelzelle eine Partie Schach nach der anderen gegen sich selbst spielt und der nach seiner Befreiung jeden Gegner problemlos matt setzt. Er wusste gar nicht, dass ein Meister aus ihm geworden war.
Ende der Ehrfurcht
In der Zeit von meinem 26. bis zum 44. Lebensjahr hatte ich sieben verschiedene Anstellungen gehabt und von Job zu Job war ich immer eine Stufe höcher geklommen. Nebenher hatte ich dabei sehr unterschiedliche Unternehmenskulturen, Geschäftsfelder und Herausforderungen kennengelernt. Dabei entwickelte ich eine Vorliebe für die Bewältigung von Krisen. Ich kam nun auf die Idee, daraus einen Job zu machen. Das wurde beflügelt durch die Bekanntschaft mit dem Paten, der in genau dieser Branche tätig war. Er hatte ein Unternehmen für die Sanierung problematischer Firmen und war auf der Suche nach guten Restructuring Officers.
Solch ein Wechsel war auch im Sinne meiner zentralen Zielsetzung, nämliche reich und unabhängig zu werden. Ich wäre auf eigene Rechnung tätig und würde Tageshonorare abrechnen, die, wenn man das ganze Jahr hart arbeitet, das Zwei- bis Dreifache meines Gehalts als Geschäftsführer bringen würden. Falls Sie die vorigen Kapitel aufmerksam gelesen haben, dann wissen Sie inzwischen besser als ich, wie es mir in diesem neuen Gewerbe ergangen ist. Sie haben Piroska kennengelernt, Ferro, Siegfried und letztlich die vierjährige Agonie bei der verdammten Grillo GmbH. Und, ich verschweige es nicht, die Rechnung ist aufgegangen, das Ziel ist erreicht. Mit 53 kann ich sagen „Mission accomplished“.
In diesen Jahren hatte ich automatisch mit Herren in gehobenen Positionen zu tun: Bankdirektoren, Unternehmern und Topmanagern.
Wie Sie hinlänglich wissen, war ich nicht in diesem Milieu groß geworden, weder gesellschaftlich noch beruflich. Ich war letztlich ein kleiner Fisch aus einfachen Verhältnissen, der alles tun musste, um sich in diesen Kreisen bewegen zu dürfen. Ich musste damit rechnen, dass man mich beim kleinsten Fehler in der Luft zerreißen würde. Für die hohen Herren mit ihren Chauffeuren, Sekretärinnen und prächtigen Büros wäre das doch ein Leichtes gewesen. Oder?
Um dem vorzubeugen, hatte ich mir angewöhnt, meine Hausaufgaben gründlich zu machen. Das hatte sich ja schon bei meinem Studium in Mathe und Physik bewährt. Außerdem blieb ich immer – so gut es ging – bei der Wahrheit. So kam es denn, dass ich in keiner der Hunderten von Besprechungen, die ich in den zehn Jahren als CRO hatte, jemals eine Bauchlandung machte. Es gab hochkarätige, knallharte Konflikte, aber niemand konnte mich jemals in der Luft zerreißen. Im Gegenteil: Es wurde immer deutlicher für mich, dass ich nichts zu befürchten hatte, dass die von mir mit solch hoher Ehrfurcht bedachten Personen auch nur mit Wasser kochten, und oft nicht einmal das.
Nieten in Nadelstreifen
Je weiter ich mich auf meinem Weg von „Rags to Riches“, vom Tellerwäscher zum Millionär bewegte – wobei der Tellerwäscher hier nicht wörtlich zu nehmen ist –, desto mehr schwand meine Hochachtung für die Bosse und Banker, desto mehr wuchs meine Sympathie und Anerkennung für die Arbeiter und kleinen Leute. Nicht dass es unter denen keine Flaschen gegeben hätte, aber ich fand hier meist mehr ehrliche Identifikation mit der Firma, mehr Sorgfalt bei der Arbeit, mehr Hingabe und mehr Fleiß als in den Chefetagen.
Es dämmerte mir, dass „dort oben“ völlig unverhohlen das persönliche Wohlergehen und die eigene Karriere verfolgt werden, zu Lasten von Verantwortung und Integrität; dass dort oben die Qualifikation zum Bilden von Seilschaften und zur Selbstdarstellung wichtiger ist als die Befähigung zu Führung und strategischem Denken. Das war eine ernüchternde Erkenntnis für mich. Und auch die Vorstellung, dass es in der Welt der Politik nicht besser wäre, tröstete mich kaum.
In diesen Tagen, während die Erstellung dieses Buches in seiner Endphase ist, erleben wir die Insolvenz von Air Berlin, verbunden mit dem Verlust von 8000 Arbeitsplätzen. Von den prominenten Topmanagern, die sich während der letzten Jahre am Steuer der Firma versucht hatten, konnte zwar keiner den Untergang der Airline verhindern, es gelang ihnen aber immerhin, die eigenen siebenstelligen Gehaltszahlungen zu sichern – auch noch für die Zeit nach der Pleite! Der großzügige Kredit der Bundesregierung wird dabei sicherlich hilfreich sein.
Großen Anteil an den Miseren, die ich in meinem Job erleben musste, hatten die beteiligten Banker. Immer wieder wurde es offenbar, dass sie bei der Vergabe von Krediten ihre Hausaufgaben nicht machen. Zu leicht lassen sie sich vom Unternehmer, der Geld braucht, mit schönen Präsentationen und noch schöneren Zahlen betören, ohne sich die Arbeit zu machen, hinter die Fassaden zu schauen. In ihrer Bank verkünden sie dann stolz: „XYZ gehört jetzt auch zu unserer Kundschaft, den haben wir der Konkurrenz vor der Nase weggeschnappt.“
Wenn der Kredit dann wackelt, ist der Kunde schuld, der keinen reinen Wein eingeschenkt hatte. Kann man das denn erwarten? Jeder weiß doch, dass man sich fürs Finanzamt anzieht wie ein Bettler und für die Bank wie ein Millionär.
Aber auch die Unternehmer, die ich kennenlernen durfte, haben mich letztlich wenig beeindruckt. Sie werden fast unweigerlich früher oder später zu kleinen Sonnenkönigen, umgeben vom Hofstaat, der ihnen nach dem Mund redet. Nur allzu gerne lassen sie sich von ihren Vasallen überzeugen, die behaupten, es gäbe keine Probleme. Wenn dann aber ganz offensichtlich der Karren im Dreck gelandet ist, dann werden die geprügelt, die gezogen haben, nicht jene, welche die falsche Richtung vorgegeben hatten.
So ist das leider: Wenn die eigenen Versäumnisse der Führungskräfte nicht mehr zu leugnen sind, dann gehen diese besonders drastisch gegen ihre Mitarbeiter vor.
Auch die Gründer einer Firma sind nicht vor Größenwahn gefeit, obwohl sie doch – im Gegensatz zu ihren Nachfolgern – all die verdreckten Ecken und Winkel, all die Problemzonen ihres Unternehmens gut kennen. Aber auch sie können die Bodenhaftung verlieren, wenn sie dem Erfolg nicht gewachsen sind. Denken Sie nur an unseren armen Siegfried.
Von meinem „Manager-Bashing“ ausdrücklich verschonen möchte ich allerdings Anton Bär, den Gründer der Baco GmbH. Ihm lag seine Belegschaft am Herzen, er war stets fair und voller Verantwortung. Er war ein großartiger Unternehmer und genießt nach wie vor meine Bewunderung und Hochachtung. Leider gestaltete sich unsere Kommunikation zu schwierig, als dass wir hätten zusammenbleiben können. Schade.
Noch weniger gute Haare kann ich an den allgegenwärtigen Beratern lassen. Ihr Können wird von Unternehmern überschätzt und sie tun alles, damit das so bleibt. Dabei könnten diese frisch gebackenen Uni-Absolventen die Aufgaben selbst nicht lösen, bei deren Bewältigung sie angeblich helfen. Ihre Kernkompetenzen sind PowerPoint, modische US-Vokabeln und hohe Rechnungen. Mein Tipp an Manager, die so jemanden anheuern wollen: Prüfen Sie den Kandidaten auf Herz und Nieren. Lassen Sie sich erklären, was er für andere Klienten erreicht hat. Fordern Sie Zahlen und Fakten. Und wenn das erste Mal das Wort „Synergie“ fällt, dann schmeißen Sie den Mann raus.
Rambo oder Robin Hood?
Und wie steht es um mich selbst, den Zauberer? Habe ich denn etwa nicht von dem System profitiert, das ich hier so vollmundig kritisiere? Natürlich habe ich gesalzene Rechnungen geschrieben und dafür gesorgt, dass sie bezahlt wurden. Natürlich habe ich bei Entscheidungen auch eigene Interessen im Auge gehabt. Aber ich habe mich nur auf Themen eingelassen, die ich besser beherrschte als meine Auftraggeber.
Neben fachlicher und intellektueller Ausstattung zeichnete mich Beharrlichkeit aus. Wenn ich vor einer Aufgabe stand, verpasste ich ihr erst einmal eine logische Struktur und setzte dann ein klares Ziel. Ein Ziel ist übrigens etwas anderes als ein Wunsch. Es ist kein „ich möchte …“ oder „es soll …“. Das Ziel ist der Zustand, der erreicht werden muss – unter allen Umständen.
Sobald ich die Koordinaten für mein Ziel einprogrammiert hatte, wurde ich zum Marschflugkörper. Nach dem Start war ich von niemandem mehr zu steuern. Unter Einsatz von Leib und Leben blieb ich auf Kurs. Ich war Rambo mit Schlips und Kragen.
Woher kam der Treibstoff für meine Überschallflüge? Er kam aus dem Hass gegen das ärmliche Arbeitermilieu, dem ich entstammte, und dem Hunger nach Anerkennung. Ich wollte zu denen da oben dazugehören. Ich wollte Geld, Ansehen und einen großen Mercedes.
Habe ich dabei meine Seele dem Teufel verkauft? Allerdings! Es hat lange gedauert, bis ich erkannte, was hinter den Kulissen der Chefetagen wirklich vorgeht. All die Jahre hatte ich mich bis zur Erschöpfung verausgabt, um den Nieten in Nadelstreifen das Vermögen zu retten, das sie durch Leichtsinn und Unfähigkeit aufs Spiel gesetzt hatten. Erst spät in meiner Laufbahn fiel es mir wie Schuppen von den Augen: Die eigentlichen Verlierer sind immer die kleinen Leute.
Das Leben ist eine Lehre, die man hat, wenn man sie nicht mehr brauchen kann. Meine Einsicht in die Ungerechtigkeit der unternehmerischen Welt kam zwar spät, aber nicht zu spät. So konzentrierte ich meine Anstrengungen in den letzten Jahren bei Grillo auf das Wohl der Mitarbeiterschaft. Meine guten Taten galten mal einzelnen Personen, mal auch der gesamten Belegschaft.
Das soll nicht heißen, dass meine vorherigen Einsätze als CRO den Mitarbeitern keinen Nutzen gebracht hätten. Das war aber eher „Kollateralnutzen“, der bei der Sanierung ohnehin abfiel. Aber urteilen Sie selbst:
Bei Piroska sicherte ich letztlich die Jobs für 250 arbeitswillige, loyale ungarische Männer und Frauen.
Nach meinem ersten Einsatz bei Grillo im Jahre 2009 hinterließ ich ein gut funktionierendes Unternehmen mit 450 sicheren Arbeitsplätzen; und nach Grillos Verkauf 2016 wurden immerhin noch 200 Mitarbeiter in den neuen Konzern übernommen, der wesentlich mehr Stabilität versprach, als Grillo mit der amateurhaften Führung durch die königliche Familie bieten konnte.
Siegfried hatte ich damals ausreden können, sein Werk und sich selbst zu vernichten. Das erhielt 200 Arbeitsplätze, heute in der Hand einer deutlich professionelleren Führung.
Das waren gute Ergebnisse, auch für die Mitarbeiter. Aber erst ab 2014, während meines zweiten Einsatzes bei Grillo, entdeckte ich die Mutter Teresa in mir, da begann ich gezielt das Wohl der Arbeitnehmer zu verfolgen. Hier ein Auszug aus meinen guten Taten:
Da war Georg, der einen überflüssigen Job schlecht erledigte. Er wäre der erste gewesen, den man bei einer Sanierung einspart. Ich hörte dann, dass er einst auf dem Heimweg im Auto einen Zusammenstoß und anschließend einen Schlaganfall erlitten hatte. Eine Kündigung wäre sein sicheres Ende gewesen. Ich schloss einen Pakt mit ihm: „Du machst das, was du kannst, und machst das gut; ich sorge dafür, dass du bleibst.“ Er hat sein Versprechen gehalten, ich auch.
Die fleißige Irene entdeckte ich an der Füllmaschine für Grillwürste. Sie tat eine wichtige Arbeit, aber es war klar, dass sie dafür überqualifiziert war. Ihre Klugheit und Ordnungsliebe könnte sie woanders besser zum Einsatz bringen. Ich drängte ihr einen Job in der Logistik auf. Das war zwar ein besserer Job, aber sie wollte ihn nicht und weinte bitterlich. Ich ließ mich nicht erweichen und sie fand schließlich doch Freude an der neuen Tätigkeit und an ihrem Fortschritt. Bei meinem Abschied von Grillo rief sie mich an und wieder flossen die Tränen. Diesmal aber aus Dankbarkeit. Alles Gute, liebe Irene.
Susi Sorglos war Lehrling. Sie fiel mir auf, weil sie in der Arbeitszeit gerne mit Freundinnen in der Kantine plauderte und rauchte. Das brachte ihrem Chef und ihr selbst erst einmal großen Ärger ein. Aber Schuld und Sühne können eine Weichenstellung zum richtigen Weg sein (ich weiß, wovon ich rede). Susi wurde erwachsen, zeigte sich zuverlässig und verantwortungsvoll, wobei sie Charme und Freude am Kontakt mit Menschen beibehielt. Ich sah ihr Potenzial, förderte und forderte sie, und mit dreißig war sie Personalchefin und Prokuristin. Sie war ein Sonnenstrahl im grauen Alltag bei Grillo. Sie wird ihren Weg gehen, auch ohne meine Unterstützung.
Die Mischung aus Gewissenhaftigkeit, Fleiß und Sozialkompetenz, wie sie bei dreißigjährigen Frauen zu finden ist, ist ein Segen für jedes Unternehmen. Die Beobachtung habe ich konsequent zu Grillos Vorteil und zum Nutzen der Betroffenen in die Tat umgesetzt. Schließlich wurden zwei Drittel der Abteilungen von solchen Kräften geführt. Dabei konnte auch jedes Mal der Wunsch nach Erhalt der Stelle während einer eventuellen Elternzeit erfüllt werden.
Ich habe noch eine weitere Erkenntnis gehabt und realisiert: Eine Person, die man jahrelang im eigenen Betrieb beobachten konnte, ist besser zu beurteilen als ein Kandidat von draußen, der vom Headhunter nach einstündigem Interview vermittelt wird. So habe ich fast alle unteren Führungskräfte intern rekrutiert, nachdem ich stets mit wachem Auge für geeignete Kandidaten durch die Firma gegangen war.
Ich bin stolz auf mein strategisches Personalmanagement, aber ich wäre nicht Mutter Teresa, hätte ich mich nicht auch der Ärmsten unter den Armen angenommen. Das waren zweifellos die osteuropäischen Kumpel, die über Werksverträge beschäftigt waren. Das war gut für die Firma, da die Leute leicht zu kündigen waren. Es war weniger gut für die Betroffenen, weil sie keine Sicherheit hatten – weder kurzfristig noch auf lange Sicht.
So bot ich den Betroffenen unbefristete Verträge an, inklusive all der Leistungen und Sicherheiten, welche auch die regulären Angestellten hatten. Die meisten akzeptierten. Für die Firma wurde das etwas teurer, aber den Arbeitern gegenüber war es nur fair. Ich nahm von den Reichen und gab es den Armen. Vielleicht bin ich doch eher Robin Hood und nicht Mutter Teresa.
| Und hier bekommen Sie den kompletten Roman |