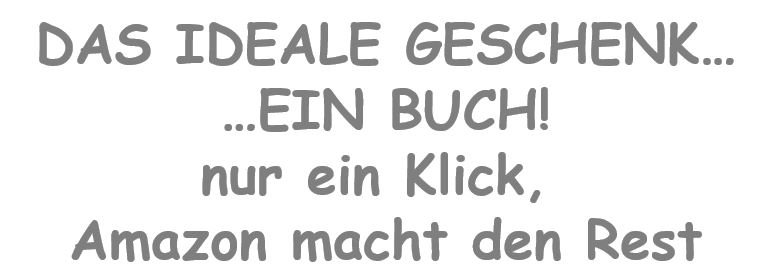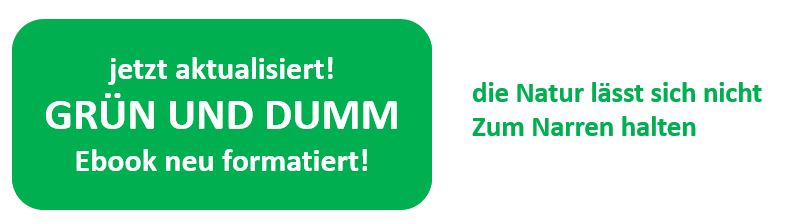Bild: Julius Drost / unsplash
Die Bank
In diesem kurzen, aber weichenstellenden Akt erscheint ein neuer Mitspieler im Vordergrund der Bühne, dessen Rolle im weiteren Verlauf des Dramas – und bis hin zu seinem tragischen Ende – immer wichtiger wird. Im vorigen Akt gab es diese Figur auch schon, allerdings stand sie im Hintergrund, ohne theatralischen Beitrag zu leisten: Es handelt sich um die Bank. Zeitweise sind auch mehrere Banken beteiligt, ich fasse sie aber unter dem Begriff „Bank“ zusammen.
Mancher glaubt, eine Bank habe beliebig viel Geld und müsse einem davon leihen, wenn man nur inständig bittet. Wenn sie nichts hergibt, dann geschieht das aus Bosheit. Siegfried war in diesem Glauben. Wir müssen daher verstehen, wie solch eine Institution funktioniert, um den Konflikt bewerten zu können, der später zwischen Siegfried und den Banken eskalieren sollte.
Der Einfachheit halber vergessen wir einmal, dass die Banken intensiv miteinander vernetzt sind, dann ist das Prinzip einfach. Die eine Klientel deponiert ihr Geld, damit es sicher ist und Zinsen bringt. Diesen Teil des Geschehens nennen die Banker das Passivgeschäft. Jetzt bleibt das Geld aber nicht im Tresor liegen, sondern es wird an eine andere Klientel verliehen. Das ist das Aktivgeschäft. Die Bank verlangt von ihren Kreditnehmern natürlich Zinsen, und diese sind höher als das, was die Bank selbst an ihre Einleger zahlt. Die Differenz heißt Zinsspanne. Von ihr lebt die Bank, wenn man von Kleinigkeiten wie Gebühren und Courtagen absieht.
Die gesamte Masse, mit der eine Bank so spielen kann, ist ihr Bilanzvolumen. Das besteht allerdings nicht nur aus Einlagen der Passivkunden, die Bank muss selbst einen gewissen Beitrag an Eigenkapital leisten. Der Gesetzgeber fordert das. Der fordert auch, dass nicht 100 Prozent des Bilanzvolumens als Kredite vergeben werden dürfen, sonst könnte man die Passivkunden, die Geld abheben möchten, nicht mehr bedienen.
Bis zu diesem Limit muss die Bank jedoch so viel wie möglich verleihen, um Gewinn zu machen. Von den Krediten wird unweigerlich der eine oder andere platzen – ein Vorgang, der im Jargon euphemistisch „Wertberichtigung“ heißt. Natürlich will man nun einerseits vermeiden, dass eine einzige Wertberichtigung den schönen Gewinn aus dem übrigen Geschäft zunichtemacht; andererseits will man sich kein lukratives Aktivgeschäft entgehen lassen, weil man zu ängstlich ist.
Würden Sie als Banker unserem Siegfried eine Kreditlinie von 10 Millionen einräumen? Ihr Bilanzvolumen beläuft sich auf eine halbe Milliarde. Bei einer Zinsspanne von 2 Prozent könnte Ihr Aktivgeschäft theoretisch maximal 10 Millionen pro Jahr erwirtschaften. Dazu würde der Kredit an Siegfried viel beitragen, vorausgesetzt, dass alles gut geht. Falls nicht, könnte eine „Wertberichtigung Siegfried“ das Aktivgeschäft eines Jahres vernichten, wahrscheinlich noch mehr.
Sie würden erst gründlich analysieren, was die Stärken und Schwächen der Firma sind, die Assets und Liabilities. Als Außenstehender, der nicht hinter die Kulissen schaut, vermuten Sie, dass die Firma in den vergangenen Jahren solide Arbeit geleistet hat, sonst wäre sie nicht gewachsen. Wie ist die aktuelle Auftragslage? Sie ist nicht gut, sie ist spektakulär! Siegfried war gerade ein Großauftrag durch die Nobelfirma mit den drei Buchstaben erteilt worden: Dreißig verschiedene Komponenten müssen für einen neuen Sportwagen gefertigt werden, dessen Produktion im Anlauf ist. Und es ist genau dieser Auftrag, der neue Investitionen erforderlich macht. So weit, so gut.
Dann gibt es noch die „intangiblen Assets“, also die Aktiva, die nicht als Zahlen in der Bilanz der Firma erscheinen. Fraglos ist die Person Siegfried das wichtigste intangible Asset. Er ist engagiert, versteht sein Handwerk, kann gut verhandeln – wenn auch sein Auftreten gewöhnungsbedürftig ist – und er hat in der Vergangenheit gezeigt, dass er in kritischen Situationen über sich hinauswächst, um das Problem doch noch zu lösen.
All das spricht für die Gewährung des Kredits, und noch ein weiterer Punkt spricht dafür: Die Bank erfüllt damit ihre soziale Verpflichtung gegenüber der Bevölkerung, denn durch besagten Großauftrag werden vorhandene Arbeitsplätze erhalten und neue geschaffen. So entscheiden Sie als Bankdirektor also zugunsten von Siegfried.
Über einen Punkt haben Sie bei Ihrer Analyse allerdings hinweggesehen: die Rechtsform der Firma. Letztere ist die eines „eingetragenen Kaufmanns“ (eK). Das ist eine sonderbare, veraltete Konstruktion, der Sie als Bankdirektor nicht mehr häufig begegnen: Sie bedeutet nämlich, dass Firma und Inhaber ein und dieselbe juristische Person sind.
Jemand, der mehr als Siegfried an den rechtlich-finanziellen Aspekten seiner Firma interessiert gewesen wäre, hätte längst aus der eK eine GmbH gemacht, um, wie der Name schon sagt, die Haftung zu beschränken. Aber jetzt sind Privat- und Firmenvermögen im selben Topf. Wenn etwas schiefgehen sollte, dann muss Siegfried sein letztes Hemd hergeben, um Verbindlichkeiten gegenüber Personal, Lieferanten oder Banken zu begleichen. Wäre er geschäftsführender Gesellschafter der Siegfried GmbH, dann wäre er in solch einem Fall aus dem Schneider, vorausgesetzt er hätte die finanziellen Probleme der Firma rechtzeitig publik gemacht. Die Firma wäre dann zwar pleite, aber sein Privatvermögen bliebe unangetastet.
Für Sie als Banker muss der eK zunächst nicht abschreckend sein, denn der Inhaber wird alles tun, um das erwähnte Pleiteszenario zu vermeiden. Eine GmbH dagegen lässt der Eigentümer schon mal „an die Wand fahren“, denn er weiß, dass der private Schaden begrenzt ist. Dennoch wäre diese ungewöhnliche Rechtsform ein deutliches Indiz für Sie gewesen, dass Siegfried in kaufmännischen Dingen äußerst naiv war.
Die Verschmelzung von Privat und Firma bestand übrigens nicht nur auf dem Papier, sie herrschte auch in Siegfrieds Bewusstsein und seinem Unterbewusstsein, welches da flüsterte: „… gehört alles mir.“
Die Genugtuung
Es gab in der Firma noch andere „intangible Liabilities“, d. h. Schwächen, die das Geschäft bedrohten, die aber nicht in der Gewinn- und Verlustrechnung standen und die der Bank verborgen geblieben waren. Diese lagen, ähnlich wie die Stärken, ebenfalls in Siegfrieds Persönlichkeit. Wo viel Licht ist, da ist auch viel Schatten.
Er trug ja noch diesen Groll aus den Anfangsjahren seines Geschäftes mit sich herum, als er sich – seiner Meinung nach – vor den Augen der Allgemeinheit erniedrigt hatte, weil er damals Tag und Nacht arbeiten musste, um mit seiner Firma und mit seiner Familie zu überleben.
Dieser Groll in Siegfrieds Herzen und der plötzliche problemlose Zugriff auf Millionen ergaben eine gefährliche Mischung. Er tat nun das, was jemand tut, der in der Schule immer ein Versager war und der kurz vor dem nächsten Klassentreffen im Lotto gewinnt. Er tat alles, um es den anderen endlich zu zeigen.
Für Siegfried waren die „anderen“ seine Mitbürger. Sicher war unter ihnen der eine oder andere, dem er es besonders zeigen wollte, aber auf der Bühne unseres Dramas sind sie namenlose Komparsen, die im Hintergrund stehen und als Projektionsfläche für Siegfrieds Show dienen. Es war eine Show, die für Augen und Ohren etwas zu bieten hatte.
Er kaufte drei Autos: eines, um ja nicht übersehen zu werden, einen gelben Porsche Cayenne, mit dem er auf der Hauptstraße Paraden abhielt. Um auch auf der Autobahn mitreden zu können, hatte er jetzt einen roten Ferrari, von dem später noch die Rede sein wird; und um sich fortzubewegen, fuhr er einen 7er BMW.
Damit war es aber nicht genug. Es konnte ja immer noch sein, dass er nicht in jedermanns Blickfeld war, während er gerade in einem seiner wichtigen Autos auftauchte. Um ganz sicher zu sein, dass man ihn auch wirklich wahrnahm, kam eine Harley-Davidson mit großvolumigem Motor dazu. Wenn er dann auf dieser Maschine in seiner Rockermontur mit wehendem Bart und flatternden Haaren, ohne Helm durch den Ort donnerte, dann schauten die Leute aus dem Fenster und sagten: „Der Verrückte ist wieder unterwegs.“
Siegfried hatte Dinge gekauft, die er sich nicht leisten konnte, um Menschen zu beeindrucken, die er nicht mochte.
Der Pilot
Was macht jemand, der schon genug protzige Autos hat, damit aber immer noch nicht zufrieden ist? Falls er noch Geld hat, dann steigt er jetzt – gesellschaftlich und räumlich – eine Etage höher: Er kauft sich ein Flugzeug. Genau das tat auch Siegfried.
An dieser Stelle müssen ein paar Worte zum Fliegen gesagt werden. Es übt auf viele Menschen eine unvergleichliche Faszination aus, sich in der Luft in drei Dimensionen zu bewegen. Viele Flugkapitäne im Ruhestand halten sich immer noch eine kleine Cessna, weil sie mit den Tausenden Flugstunden in Boeings und Airbussen noch nicht genug haben. Dann finden wir auch Jungs, die gemeinsam ihr Bares zusammenkratzen, um eine Jahrzehnte alte Maschine zu kaufen, die sie in viel Kleinarbeit am Wochenende herrichten, polieren und vielleicht auch fliegen.
Fliegen ist eine anspruchsvolle Tätigkeit, die Hingabe und Training erfordert. Von einer Minute auf die andere kann aus einem beschaulichen Vergnügen eine nervenaufreibende Strapaze werden, in der ein Pilot alle Sinne zusammen haben muss, um zu überleben. Die Naturgesetze des Fliegens sind unerbittlich. Jemand, der es gelernt hat, im normalen Leben durch Beziehungen, Arroganz oder Charme voranzukommen, der erkennt, manchmal erst zu spät, dass er damit gegen Sturm und Motorschaden nichts ausrichten kann.
Wenn also jemand sich ein Flugzeug aus Prestigegründen kauft, ohne die notwendige Zeit für Training und ohne Hingabe an die Fliegerei aufzubringen, dann macht er einen gefährlichen Fehler. Es gibt einen Flugzeugtyp der Oberklasse, der in den USA den Beinamen „Doctor Killer“ trägt. Offensichtlich haben sich etliche erfolgreiche und vielbeschäftigte Halbgötter in Weiß so einen Flieger zugelegt und mussten dann auf die harte Tour lernen, dass auch sie sterblich waren.
Siegfried benutze seine Cessna hauptsächlich, um am Wochenende seine Liebste in Ungarn zu besuchen, die er vor einigen Monaten kennengelernt hatte. Auf sie wird er als Flyboy bestimmt Eindruck gemacht und davon auch profitiert haben, denn: „Piloten ist nichts verboten.“ Man muss Siegfried zugutehalten, dass seine, wie wir später sehen werden, allerdings recht kurze Pilotenkarriere ohne Zwischenfälle verlief. Das spricht auf jeden Fall wieder für ihn.
Der Manager
Ziehen wir an dieser Stelle Bilanz. Siegfried hatte nun den Auftrag, den Kredit und die Spielzeuge, die er haben wollte. Alles, was er jetzt noch tun musste, war, den Auftrag auszuführen, für einen Kunden, der hinsichtlich Terminen, Qualität und Kosten unerbittlich war. Würde ihm das gelingen oder würde er Kunden und Bank, die Vertrauen in ihn gesetzt hatten, enttäuschen?
Das alte Werk war für die neuen Aufgaben nicht mehr geeignet. Die Fertigungskapazität musste gesteigert werden und man brauchte mehr Platz für die Lagerung der fertigen Endprodukte und des Rohmaterials. Siegfried nahm dies zum Anlass, eine ganz neue Fabrik zu bauen, die nicht nur größer, sondern auch wesentlich repräsentativer ausfiel als die bisherige Anlage. Seine Begabung für handwerkliche, technische Dinge kam ihm beim Bau zu Hilfe. Seine kaufmännische Naivität und das Fehlen strategischen Denkens allerdings führten dazu, dass er wesentlich mehr Geld ausgab, als notwendig gewesen wäre. Aber er hatte nun ein Stück mehr, auf das er stolz sein konnte, auch wenn es letztlich Eigentum der Bank war.
Mit dem neuen Gebäude war es nicht getan. Um die Produktionskapazitäten zu steigern, brauchte es auch mehr Personal, und so wurde die Mannschaft auf 300 aufgestockt. Über die Probleme, qualifizierte Mitarbeiter zu finden, hatte ich schon berichtet; dieses Problem war in der Zwischenzeit keineswegs behoben. Thüringen ist kein Magnet für Könner, und so mussten regionale Kräfte angeheuert werden, die nicht gerade erstklassig waren. Wie aber stand es um den Chef? War er ausreichend qualifiziert, um den Laden zu schmeißen? War er mit der Firma mitgewachsen? War aus dem Schlosser ein Manager geworden?
Management bedeutet, die richtigen Ziele zu setzen und dafür zu sorgen, dass sie erreicht werden. Muss man das lernen? Schon als Kleinkinder setzen wir uns Ziele und wissen sie zu erreichen. Unser liebster Teddy fällt aus dem Bettchen und das Ziel ist, ihn wiederzuhaben. Also schreien wir, bis jemand kommt, versteht, worum es geht, und dann unseren Wunsch erfüllt. Sind wir nicht alle geborene Manager?
Genau das ist das Problem. Denn viele behalten als Führungskräfte diesen Stil bei – natürlich verfeinert durch höhere Intelligenz, mehr Wissen und Menschenkenntnis. Die Basis bleibt aber unverändert: situativ und intuitiv. Das mag im kleinen Kreise bei wenigen und überschaubaren Aufgaben funktionieren – aber auch mit 300 Mann?
Kompetenz in Personalführung und Organisation erwirbt man sich nicht automatisch im Laufe der Zeit. Dafür muss man unter Anleitung lernen und trainieren, so wie auch in ganz anderen Bereichen des Lebens.
Anders als Skifahren oder Joggen kann man Golf nicht ohne intensiven Unterricht lernen. Niemand käme von sich aus auf die Idee, den Schläger in die „falsche“ Hand zu nehmen und dann nur mit den drei letzten Fingern zu halten, während Daumen und Zeigefinger unbeteiligt bleiben. So wird dann ausschließlich „Rückhand“ gespielt, um diesen Ausdruck vom Tennis zu borgen; der „starke“ Arm schwingt dabei nur antriebslos mit, anderenfalls würde man in den Rasen hacken.
Nun werden Sie auf den Fairways auf Autodidakten treffen, die ihren Schwung selbst erfunden haben. Man erkennt sie sofort an ihren hektischen Bewegungen und am lauten Fluchen. Würde man solch einem Kandidaten – nach dem Spiel – den guten Rat geben, den Schläger nicht wie einen Vorschlaghammer anzufassen, dann würde der etwas pikiert erklären, dass er schon immer so spiele und dass jede kleinste Änderung den ganzen Schwung zerstöre. Der Autodidakt ist beratungsresistent.
Auch im Business gibt es Themen wie Organisation, Führung und Finanzen, die nicht autodidaktisch durch „Learning by Doing“ beherrschbar werden. Hier müsste ein Selfmademan wie Siegfried externe Hilfe holen. Aber nachdem er beim Aufbau seiner Firma schon so viele Dinge richtig gemacht hat, die er nie systematisch gelernt hatte – warum sollte es gerade bei diesen Themen anders sein? Und so folgte er auch hier seiner Intuition. Gute Ratschläge, insbesondere von studierten Beratern, würden ihm nur auf die Nerven gehen.
Diese Lernresistenz sollte böse Folgen haben. Da war Siegfried übrigens in guter Gesellschaft. Steven Jobs, der seine schwere Krankheit ausschließlich mit alternativen Heilmethoden besiegen wollte, hatte von Freunden und Ärzten immer wieder den guten Rat bekommen, sich schulmedizinisch behandeln zu lassen – und er hatte diesen guten Rat immer wieder abgelehnt. Als er dann erkannte, dass es zu spät war, gab er zu, dass dies der größte Fehler in seinem Leben gewesen sei. Seine Begründung war logisch: In seinem Geschäft war er gerade deshalb so erfolgreich gewesen, weil er den vielen guten Ratschlägen, die man ihm gegeben hatte, nicht gefolgt war. Seine grandiose Überlegenheit in unternehmerischen Entscheidungen hat er dann leichtsinnigerweise auch bei medizinischen Fragen für sich beansprucht. Die Einsicht in seinen Fehler kam leider nicht früh genug.
In Siegfrieds Firma war die Formel nach wie vor: „Der Chef hat das Sagen und er hat immer recht.“ Seine wichtigste Führungsmaßnahme war es, jemanden spontan zu feuern, wenn er sich über ihn geärgert hatte. So hatte jeder Angst, dass ihn der nächste Blitz treffen könnte. In diesem Klima kam auch unter den Kollegen kein Vertrauen auf – keine gute Voraussetzung für Teamarbeit, die immer wichtiger wurde. Die cholerischen Ausbrüche des Chefs ließen kein Gefühl für Zusammengehörigkeit aufkommen. Mit Egoismus, Manipulation und Intrigen versuchte jeder seine eigenen Ziele zu erreichen.
Aber nicht nur bei der Personalführung haperte es. Siegfrieds Firma war längst an einer kritischen Wachstumsgrenze angelangt, welche etwas erforderte, was auch als „Organisation“ bezeichnet wird. Das ist der Moment, in dem so manche aufstrebende Firma eine Krise durchlaufen hat oder gar gescheitert ist. Es ist eine der wenigen Situationen, in denen man einen Managementberater fragen muss, denn warum sollte man das Rad neu erfinden? Allerdings war Siegfried, wie Sie sich vielleicht denken können, im höchsten Grade „beratungsresistent“.
Der Begriff Organisation wird viel verwendet, ohne dass klar ist, was damit gemeint sein soll. In der Betriebswirtschaft spricht man von Aufbau- und Ablauforganisation. Erstere beschreibt die sinnvolle, den Aufgaben der Firma und den Personen optimal angepasste Verteilung der Verantwortungen. Das gab es bei Siegfried nur für die Bereiche Personalwesen und Finanzen, wobei Rechte und Pflichten hier auch nicht klar beschrieben waren, aber Siegfried vertraute den beiden einfach. Es waren so ziemlich die Einzigen in seinem Hause, denen er vertraute.
Die Ablauforganisation betrifft die Definition, Optimierung und Standardisierung der Prozesse in einer Firma. Man würde ja die ganze kollektive Erfahrung ungenutzt lassen, wenn jeder so vorgehen würde, wie es seinem Temperament und seinem individuellen Wissensstand entspricht. Sicherlich waren bei Siegfried die Abläufe an den Maschinen klar definiert – das war ja auch seine Kernkompetenz. Darüber hinaus aber nahmen die Dinge ihren Lauf, je nachdem wer sich gerade damit befasste.
Das ist besonders gefährlich in Betrieben, die nicht jeden Tag dasselbe machen, sondern heute dies und morgen jenes. Genau das aber war hier der Fall. Jetzt braucht man Projektmanagement – eine Disziplin, die noch schwieriger zu implementieren ist als das Management der Routineaufgaben. Bei Siegfried gab es das natürlich gar nicht. Man handelte aus der Situation heraus und spielte Feuerwehr, wenn Probleme auftraten, die mit etwas Planung durchaus vorhersehbar und vermeidbar gewesen wären.
Die Tragweite dieser Planlosigkeit sieht man sofort, wenn man sich vor Augen hält, was alles zu tun ist, bis solch ein Spritzgussteil ins Auto montiert werden kann. Es beginnt damit, dass der Automobilbauer technische Zeichnungen liefert, aus denen sich die genaue Gestalt der Werkzeuge ergibt. Dabei müssen auch noch fertigungstechnische Aspekte berücksichtigt werden, denn das Ding soll ja die richtige Dicke haben und es soll sich problemlos aus der Form lösen, wenn es sich abgekühlt hat. Die ersten Proben, die aus der Maschine kommen, werden dann vom Kunden genau unter die Lupe genommen, und in neun von zehn Fällen wird der nicht zufrieden sein.
Die Änderungswünsche werden umgesetzt, bis das Teil akzeptiert ist. Dieses ist nun das Vorbild für die Serienfertigung. Und jetzt muss der Lieferant auch noch beweisen, dass er in der Lage ist, identische Kopien des Vorbildes in der Menge zu fertigen. Erst dann gibt es grünes Licht für die Serienproduktion.
Nun gibt es da ein paar hundert Leute und dreißig verschiedene Teile, die unter Zeitdruck entwickelt und gefertigt werden müssen. Wie wollen Sie entscheiden, wer was bis wann machen soll, wenn es keine Projektorganisation gibt, wenn der Überblick fehlt?
Die Zeichen an der Wand
Neben fehlender Organisation und geringer Loyalität der Belegschaft gab es noch einen dritten strategischen Engpass: schwindende Präsenz des Chefs. Dieser Faktor verschlimmerte die Auswirkungen der ersten beiden Schwachpunkte dramatisch. Ohne Chef tat jeder, was er wollte, und ohne Chef durfte kaum eine Entscheidung gefällt werden. Also stockten die Dinge, auch wenn Arbeitsbereitschaft seitens der Belegschaft dagewesen wäre.
Es war wie in einer Paviankolonie: Wenn der Alpha nicht oben am Felsen hockt, dann balgt sich die vielköpfige Meute und treibt Unfug. Warum aber fehlte unser Alpha Siegfried jetzt so häufig? Im Rausche des Erfolges und des Geldes hatte sein Hochmut die Vernunft überrollt. Er sah die Wirklichkeit und ihre Anforderungen nicht mehr. Die Prioritäten hatten sich für ihn verschoben. Insbesondere die häufigen Reisen im eigenen Flugzeug nach Südosteuropa waren für ihn jetzt wichtig, von denen er montags erst gegen 11:00 Uhr in die Firma zurückkam.
So kam eines zum anderen: illoyale Mitarbeiterschaft, keine Organisation und ein Chef, der sich lieber vergnügt statt zu arbeiten. Diese drei Mängel waren drei Stiche ins Herz der Firma, und der letzte sollte tödlich sein. Der anspruchsvolle Großauftrag musste scheitern. Die Zeichen an der Wand waren nur allzu deutlich zu sehen.
| Und hier bekommen Sie den kompletten Roman |